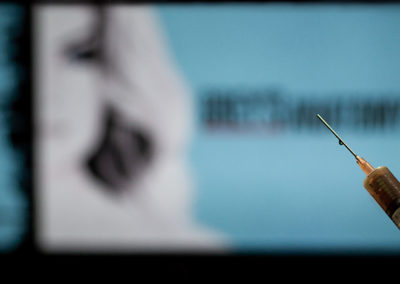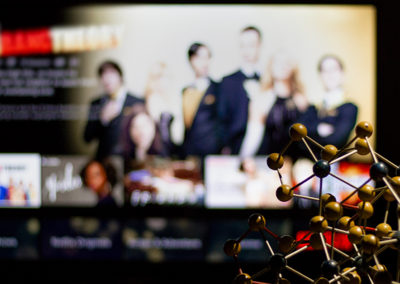The Wire
Ein Amerika im Krieg mit sich selbst

Das Kabel steht symbolisch für ein Abhörgerät – die Telefone der Verdächtigen werden damit abgehört. Foto: Lena von Heydebreck
Nein, einfach macht es diese Serie dem Zuschauer nicht: The Wire zeigt schonungslos das Leben und Sterben in der drogenverseuchten Stadt Baltimore im US-Bundesstaat Maryland. Gut und Böse, solche Kategorien zählen nicht viel an den Straßenecken in „Bodymore, Murderland“, wo die Schwachen einfach auf der Strecke bleiben und selbst die Starken jeden Tag aufs Neue ums Überleben kämpfen müssen. Ein moralischer Kompass ist ein Luxus, den sich niemand leisten kann, in dieser Stadt im ständigen Kriegszustand, diesem realen „Gotham City“. Oder wie Police-Commissioner Ervin Burrell sagt: „Das hier ist Baltimore. Die Götter werden uns nicht retten.“
Über fünf Staffeln – jede zerrt ein anderes soziales Milieu (z.B. das marode Schulsystem, die korrupte Politik oder den dahinsiechender Lokaljournalismus) unter das Brennglas – erschafft der frühere Polizeireporter David Simon einen Mikrokosmos, den er selbst als ein „Amerika im Krieg mit sich selbst“ beschrieb. Der Kampf gegen die Drogen ist ein Hamsterrad aus Gewalt, Willkür und menschlichen Abgründen. Alles fast dokumentarisch in Szene gesetzt und – abgesehen vom großartigen Titelsong „Way Down in the Hole“ von Tom Waits – allenfalls spärlich mit Musik untermalt. Wer Hochglanz und Glamour sucht, ist hier falsch. Menschen oder Gebäude – die meisten sind hier Ruinen, verkommen und schäbig.
So etwas wie klassische Hauptfiguren kennt die Serie nicht: Am ehesten noch James „Jimmy“ McNulty (Dominic West), ein alkoholkranker Mordermittler, der erst seine Ehe ruiniert und dann seine Karriere. Unter den vielen brillanten Figuren stechen jedoch anderer besonders hervor: Der aufstrebende Politiker Tommy Carchetti (Aiden Gillen, der „Kleinfinger“ aus GoT), der smarte Drogenboss Russel „Stringer“ Bell (Idris Elba) und Omar Little (Michael K. Williams).
The Wire – benannt nach den Kabeln und Leitungen der Abhörgeräte, mit denen Polizisten Drogendealer jagen – gilt als eine der ersten Qualitätsserien von HBO und bis heute als Maßstab für hartes, realistisches Fernsehen. Obwohl die Serie nur wenige TV-Preise abräumte – manche Kritiker forderten stattdessen den Literatur-Nobelpreis – waren ihre abgründigen und weit verzweigten Plots und die meist grobschlächtigen, aber fein gezeichneten Charaktere im Fernsehen der frühen 2000er Jahre eine Revolution, die Serien wie Breaking Bad oder Game of Thrones erst den Weg ebneten.
Nicht umsonst gilt The Wire als Lieblingsserie des früheren US-Präsidenten Barack Obama: Gesellschaftliche Makro-Probleme wie Rassismus, Armut oder fehlende Perspektiven sind meist zu komplex, um sie im fiktionalen Stoff aufzuarbeiten. The Wire stellt sich dieser Herausforderung, legt unerbittlich den Finger in die Wunden der amerikanischen Gesellschaft und zerstört alle Illusionen: Es wird nicht besser, sondern nur auf eine andere Weise schlimm. Und so merkt auch der Zuschauer schon lange vor dem Ende der fünften Staffel, dass der tägliche Kampf um Drogen, Macht und Überleben in Baltimore in Wirklichkeit gar kein Krieg sein kann, denn: „Kriege enden irgendwann“.
Text: Janis Brinkmann, Foto: Lena von Heydebreck