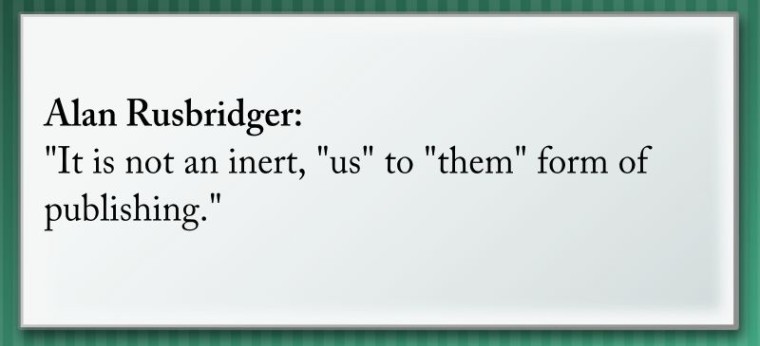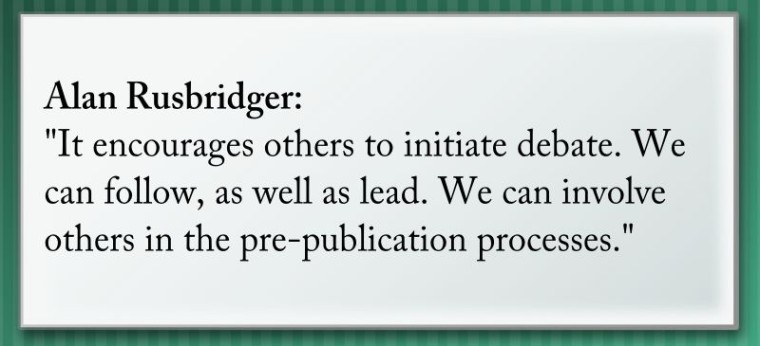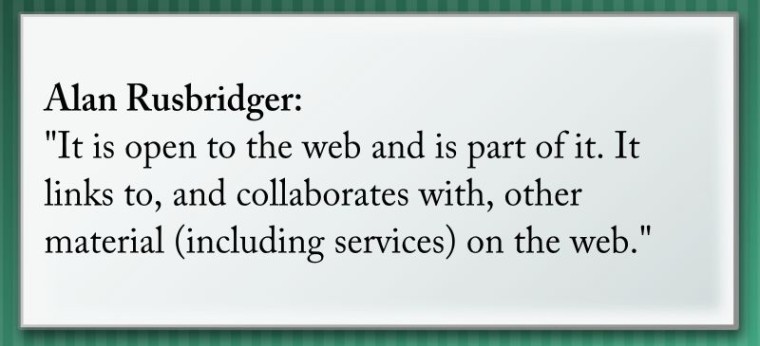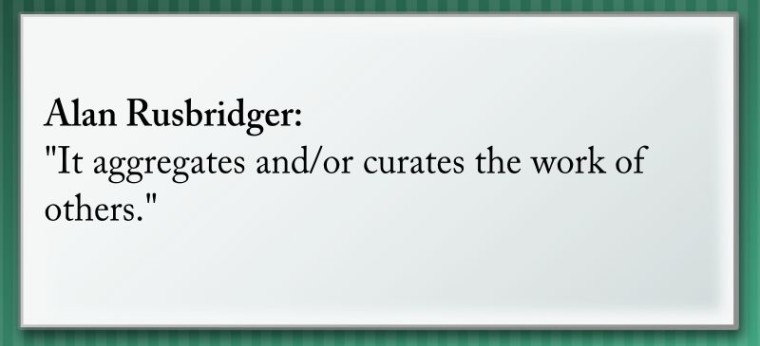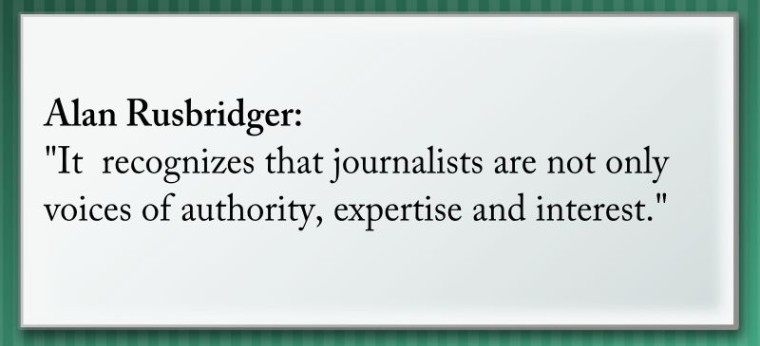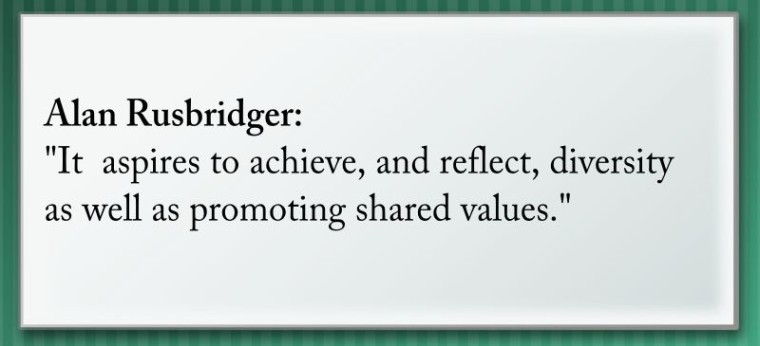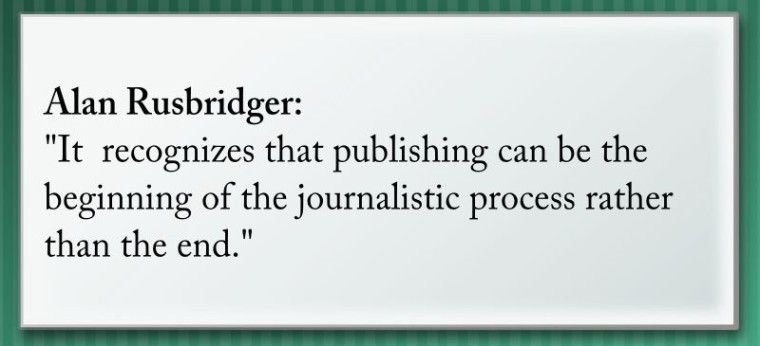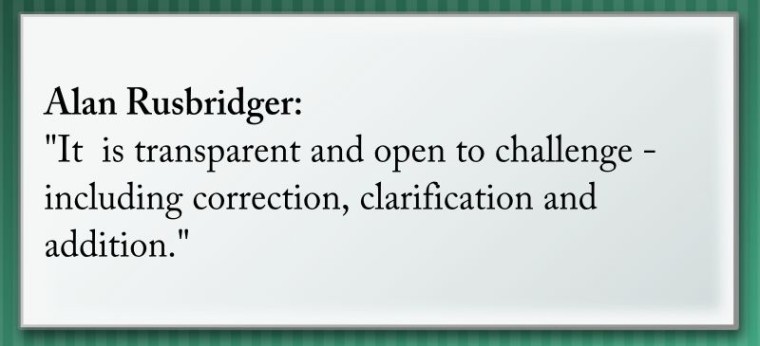Journalisten stehen heute vor völlig neuen Herausforderungen. Von ihnen erwarten Internetnutzer eine zunehmende Offenlegung und Transparenz ihrer Recherchearbeit, sowie eine direkte Kommunikation mit der breiten Netzgemeinschaft. „Open Journalism“ − eine neue Methode redaktioneller Arbeitweise, die für den User vollkommen „offen“ gehalten wird. Doch ist dieser Journalismus wirklich transparent genug?
Der Begriff und das Prinzip des „Open Journalism“ gewann 2012 durch niemand geringeren als den Chefredakteur des „Guardian“ − Alan Rusbridger − an Popularität. Er stellte die zehn Thesen des „Open Journalism“ auf, mit denen er versuchte, das Phänomen Journalismus im Netz greifbar zu machen:
Oder etwas kürzer zusammen gefasst: „Be of the web, not on the web.” Medien müssen ein Teil des Netzes werden und nicht nur ihre „herkömmlichen Produktionsweisen und Inhalte auf das Internet übertragen“, wie es Medienjournalistin Ulrike Langer in ihrem Blog „medialdigital“ formuliert. Was „Open Journalism“ nun genau bedeuten und wie er funktionieren kann, versuchte der „Guardian“ damals in einem amüsanten Werbevideo für seine Kampagne „Open Journalism – How to get involved“ zu verdeutlichen:
Im Rahmen der Kampagne rief der „Guardian“ auf seiner Website die Nutzer immer wieder zur Beteiligung auf, indem sie beispielsweise die Artikel in sozialen Netzwerken verlinken, Einblick in die Arbeit der Journalisten gewinnen können oder sogar eigene Bilder auf der Website des „Guardian“ teilen. Denn das Internet hat den Journalismus verändert – oder zumindest seine Möglichkeiten.
Im Wandel von Sender und Empfänger
Mit dem Internet ist die Zahl der Empfänger für journalistische Beiträge nicht einfach nur größer geworden, sondern die Rolle derer, die journalistische Inhalte verfolgen, hat sich verändert – vom passiven Empfänger zum aktiven Nutzer. Denn zwischen Sender und Empfänger herrschte früher eine relativ einseitige Beziehung. Der einzig offene Rückkanal bestand – zumindest im Bereich der Zeitungen und Magazine – im Verfassen eines Leserbriefes, der dann in folgenden Ausgaben abgedruckt werden konnte.
Doch welche Leserbriefe es in die Zeitung schafften, ob sie in voller Länge, gekürzt oder umformuliert abgedruckt wurden oder ob sich überhaupt jemand die Zeit nahm, sämtliche Leserbriefe zu durchforsten, lag stets im Ermessen der Redakteure selbst. Kein Leser wusste, wie viele Briefe mit welchen Inhalten die Redaktion erhielt und selbstverständlich konnte jeder nachvollziehen, dass nicht alle Leserbriefe in einer Ausgabe gedruckt und damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnten.
Leserbrief 2.0
Ein Umstand, der so im Netz nicht mehr gegeben ist: Wer hier Kommentare grundlos unterdrückt, zensiert oder sperrt und somit anderen Nutzern vorenthält, riskiert es, den Unmut der „Community“ auf sich zu ziehen. Offenheit im Umgang mit dem Feedback der User wird heute von vielen regelrecht erwartet: So beschweren sich beispielsweise viele User in den Kommentaren, wenn vorangegangene kritische Äußerungen gelöscht wurden. Und mit negativer Kritik sind die Nutzer selten zimperlich – war es doch nie so einfach, seiner Meinung direkt freien Lauf lassen zu können.
Denn wer früher einen Leserbrief mit überwiegend negativer Kritik verfassen wollte, dem musste das Blatt beziehungsweise sein Anliegen mindestens so wichtig sein, dass er den damit verbundenen Aufwand auf sich nahm, eigenhändig einen Leserbrief zu verfassen und abzuschicken. Und das, ohne genau zu wissen, ob sein Brief überhaupt jemanden erreicht. Diese Hürde ist heute wesentlich geringer − insbesondere, da die Kommentierenden in ihrer Position auch weitestgehend anonym bleiben können, sofern sie es möchten.
Grenzenlose Meinungsmacht der User?
Skeptiker des Prinzips „Open Journalism“ sehen aus diesem Grund wenig Anlass, den Kommentaren unter ihren Artikeln eine größere Aufmerksamkeit zu widmen oder gar auf sie zu antworten. „ZEIT“-Reporter Wolfang Uchatius meinte dazu in einem Interview mit dem Medienmagazin „journalist“:
„Ich habe den Text ja unter anderen Bedingungen geschrieben als die Leser ihre Kommentare. Ich habe nachgedacht, ich hatte Zeit […]. Das, was ich da geschrieben habe, ist das, was ich glaube, schreiben zu können, und wenn ich dem noch etwas hinzuzufügen hätte, hätte ich es nicht geschrieben.
[…] Ich empfinde aber die Onlinekommentare als große Bereicherung. […] Mit Bereicherung meine ich nicht, dass ich alle Kommentare gut finde. Ich finde sie aber interessant.“
Was Uchatius hier als „interessant“ betitelt, ist das große Potential, dass in den Usern steckt. Die Leser wissen oftmals mehr, als der Verfasser eines Artikels oder Beitrags, insbesondere dann, wenn sie selbst in den Geschichten stecken, von denen der Journalist „nur“ erzählt. Die Kommentarfunktion eines Artikels ist nicht nur ein Ort, in dem Menschen ihre Meinung zu einem Artikel abgeben und auf grammatikalische oder inhaltliche Fehler hinweisen können, sondern sie gibt ihnen die Möglichkeit, das Thema um weiteren „Input“ und ihre eigenen Geschichten zu erweitern. Schon deshalb kann der Journalist darin interessante weiterführende Informationen und eventuell sogar Stoff für weitere Recherchen und Themen finden.
Doch nicht nur der Journalist kann einen Mehrwert aus den Geschichten und Meinungen seiner Leser beziehungsweise Zuschauer ziehen: Auch für die User kann ein solcher offener Umgang eine Bereicherung darstellen. Diskussionen unter den Usern sollten deshalb auf keinen Fall unterdrückt werden. Am interessantesten kann es nämlich dann werden, wenn sich die Nutzer − insbesondere diese mit konträr verlaufenden Meinungen − aufeinander beziehen und nicht mehr nur auf den Artikel. Solche Wortgefechte und Argumentationsketten können teilweise interessanter sein und mehr Denkanstöße geben als der eigentliche Artikel, aus dem sie hervorgegangen sind.
Doch mit einer Kommentarfunktion unter jedem Artikel sind die Möglichkeiten des „Open Journalism“ noch längst nicht abgedeckt. Es geht darum, zusammen Journalismus zu betreiben: „What we can produce on our own is less good than what we can produce in combination with other people“, erläuterte Alan Rusbridger dazu mit Bezug auf das Potential, das im „Open Journalism“ steckt.
Journalistische Transparenz
Dass man im Internet zusammen mehr erreichen kann als im Alleingang, zeigten nicht zuletzt schon die zahlreichen Projekte, die sich erfolgreich über „Crowdfunding“ finanzieren konnten. Für Journalisten gibt es sogar ein eigenes deutsches „Crowdfunding“-Portal namens „Krautreporter“. Journalisten haben dort die Möglichkeit, ihre Projekte vorzustellen und finanzielle Unterstützung zu sammeln, um ihre Projekte dann über die Plattform finanzieren zu können.
Über das gerade entstehende Portal „hostwriter“ sollen dann sogar einfacher direkte Ansprechpartner in der Umgebung gefunden werden. Das Projekt will ein ausgebautes Netzwerk von Journalisten bereitstellen, dass es ermöglichen soll, einen Fachmann beziehungsweise Journalisten in seiner Nähe zu finden, der einen bei der Recherche unterstützt. Dies soll vor allem für Journalisten, die im Ausland oder außerhalb ihrer Heimatstadt aktiv sind, eine große Unterstützung darstellen.
Dieser Art der kollaborativen Recherche ist natürlich auch unter den Usern möglich: In der simpelsten Form, in dem man seinen „Twitter-Followern“ einfach Fragen stellt und deren Antworten auswertet, um beispielsweise unbekannte Personen auf einem Foto zu identifizieren. Doch die User können Journalisten auch noch in größerem Stil über das sogenannte „Crowdsourcing“ unterstützen: Sie werden zum elementaren Bestandteil der Recherche. Ein Beispiel für eine solche Aktion gab es unter anderem 2013 von der „ZEIT“ zu sehen: Innerhalb dieser Aktion forderte sie die User dazu auf, anonym ihre jeweiligen Dispozinsen ihrer Banken anzugeben, um dann am Ende ein Bild über eben jene Unterschiede bei den Banken geben zu können.
„The internet is killing journalism“
Im „Open Journalism“ geht es darum, den Menschen die Geschichten so gut es geht näher zubringen. Dazu gehört auch, andere erzählen zu lassen und auch dann auf gute Beiträge hinzuweisen, wenn diese von einem direkten Konkurrenten veröffentlicht wurden. Doch „Open Journalism“ bedeutet auch, seine Quellen und Arbeitsschritte − bis zu einem gewissen Maße − offen zu legen, um den Usern die „Story“ und den Arbeitsprozess weiter öffnen zu können.
Das sind jedoch auch einige von vielen Gründen, warum Skeptiker im „Open Journalism“ nicht die Zukunft des Journalismus sehen − oder zumindest nicht sehen wollen. Sie verstehen nicht, warum sie auf ihre Konkurrenten verweisen sollten. „Open Journalism“ beansprucht ihrer Meinung nach außerdem zu viel vergeudete Zeit, die Einbeziehung der objektiven Nutzer ermögliche keinen „richtigen“, professionellen Journalismus. Der britische Journalist Nick Davies formulierte die Gefahr, die seiner Meinung nach von der offenen Verbindung mit dem Internet und Journalismus ausgeht, sogar noch drastischer:
„In 20 years’ time there won’t be any newspapers left to do this. All these millions of hits won’t pay our salaries. The internet is killing journalism.“
Und in gewisser Weise mag Davies mit seiner Aussage sogar Recht haben. Das Internet vernichtet den Journalismus – oder genauer gesagt, den Beruf des klassischen Journalisten. Denn es stellt die Geschichten und Themen, die im Journalismus erzählt werden, in den Vordergrund und löst sie von den Redakteuren und Journalisten, die diese Themen in Artikeln bearbeiteten. In diesem Rahmen konnten sie die Themen für sich „beanspruchen“, denn sie verdienten mit eben diesem Zusammentragen und Interpretieren von Fakten und Wissen ihr Geld. Die Arbeit des Journalisten war getan, sobald sein Artikel oder Beitrag veröffentlicht wurde. Im „Open Journalism“ geht der journalistische Arbeitsprozess jedoch noch weiter darüber hinaus.
Geschlossener vs. offener Journalismus
Ob ein Journalist zum Verfechter oder Gegner des Gedanken des „Open Journalism“ wird, hängt schlussendlich lediglich damit zusammen, welche Rolle Journalismus seiner Meinung nach erfüllt. Katharine Viner, Journalistin und stellvertretende Redakteurin des „Guardian“, fasste diesen Gedanken wie folgt zusammen:
„[…] if you believe that the role of the journalist is as an outsider, then you will be in favour of the open web, open journalism, the free flow of engagement and challenge and debate with the people formerly known as the audience.
But if you think journalism is instead for brokering power, influencing power, keeping power, then you will want to close down the web as much as possible and keep debate to a minimum. More about your own interests, less about the public interest.“
Im „geschlossenen“ Journalismus geht es um die Artikel, die ein Journalist schreibt. Im „offenen“ Journalismus geht es um die Themen, die er behandelt und die Möglichkeit, diese so gut es geht vernetzend abzudecken. „Open Journalism“ ist deswegen definitiv die bessere Form des Journalismus: Er ermöglicht völlig neue Formen der Recherche, bietet Quellen und Anreize für weiterführende Denkanstöße und lässt die Menschen gemeinsam Journalismus betreiben − mit Ergebnissen, die im Alleingang so oft nicht möglich gewesen wären.
Doch für den Journalisten, der nicht bereit ist, sich diesen neuen Möglichkeiten und Chancen anzupassen, Neues auszuprobieren und dessen bisheriger Arbeitsstil und Arbeitsplatz durch seine „Nichtanpassung“ gefährdet ist, ist „Open Journalism“ tatsächlich nicht die bessere Alternative. Weil es um die Geschichten geht und nicht um die Journalisten.
Text: Tim Bergelt. Artikelbild: Kristin Jacob; Quellen: www.flickr.com, Fotograf: Mohammad A. Hamama (Hintergrundbild), www.all-free-download.com (Icons). Slider: Tim Bergelt. Video: „The Guardian“.